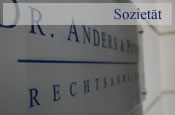Info/Service – Familienrecht
- Düsseldorfer Tabelle
- Trennungsunterhalt:
Wendet sich der Unterhaltsgläubiger schon während der Ehe einem anderen Partner zu, mit dem er nach der Trennung in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, so kann der Trennungsunterhaltsanspruch bereits nach § 1579 Abs. 6 BGB verwirkt sein (KG FamRZ 2006, S. 1542).
- nachehelicher Unterhalt:
Bei einer langjährigen Beziehung kann auch dann von einer eheähnlichen Gemeinschaft gesprochen werden, wenn die Partner nicht zusammenleben, ein Zusammenzug auch nicht geplant ist, die Beziehung im Übrigen aber auf Dauer angelegt ist - hier: dokumentiert durch gemeinsame Nennung unter der Todesanzeige der Mutter des Partner, gemeinsame Urlaube und Beistandleistung in persönlichen Angelegenheiten - (OLG Koblenz FamRZ 2006, S. 1540).
- Selbstbehalt:
Der Selbstbehalt gegenüber einem Anspruch auf Trennungsunterhalt oder nachehelichen Unterhalt (Ehegattenselbstbehalt) kann nicht generell mit dem Betrag bemessen werden, der als notwendiger Selbstbehalt gegenüber Unterhaltsansprüchen Minderjähriger oder ihnen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellter Kinder im Rahmen des Verwandtenunterhalts gilt. Er ist vielmehr in der Regel mit einem Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen Selbstbehalt (1.100,00 €) und dem notwendigen Selbstbehalt (890,00 €) - d. h. also im Regelfall 995,00 € - liegt (BGH, FamRZ 2006, S. 683).
- Kindesunterhalt:
Ein vollschichtig erwerbstätiger Unterhaltsschuldner minderjähriger Kinder ist zur Aufnahme einer Nebentätigkeit verpflichtet, wenn ihm dies im Einzelfall zumutbar ist und ihn zeitlich und physisch nicht unverhältnismäßig belastet (OLG Düsseldorf, FuR 2006, S. 425).
- Elternunterhalt:
Auch im Rahmen des Elternunterhalts muss der Unterhaltsschuldner grundsätzlich den Stamm seines Vermögens einsetzen. Er braucht aber unter Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen seinen eigenen angemessenen Unterhalt einschließlich einer angemessenen Altersvorsorge nicht zu gefährden. Dabei steht es ihm frei, in welcher Weise er neben der gesetzlichen Altersvorsorge Vorsorge für sein Alter trifft. Sichert er den Fortbestand seiner gegenwärtigen Lebensverhältnisse durch Sparvermögen oder ähnliche Kapitalanlagen, muss ihm davon jedenfalls der Betrag verbleiben, der sich aus der Anlage der ihm unterhaltsrechtlich zuzubilligenden zusätzlichen Altersvorsorge (bis zu 5 % des Bruttoeinkommens beim Elternunterhalt) bis zum Renteneintritt ergäbe (BGH, FamRZ 2006, S. 1511).
- Versorgungsausgleich:
Ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs nach § 1587 c Nr. 1 BGB kann gerechtfertigt sein, wenn ein Selbstständiger es unterlässt, Altersvorsorge zu betreiben und dies als illoyal und grob leichtfertig zu bewerten ist (OLG Karlsruhe, FamRZ 2006, S. 1457).
- Sorgerecht:
Der vorläufige Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Wege der einstweiligen Anordnung setzt voraus, dass ein dringendes Bedürfnis für ein unverzügliches Einschreiten besteht. Ist eine einstweilige Anordnung bereits über längere Zeit vollzogen, so entspricht es grundsätzlich nicht dem Wohl des Kindes, die getroffene Maßnahme im Beschwerdeverfahren abzuändern und einen erneuten Ortswechsel des Kindes herbeizuführen (OLG Hamm, FamRZ 2006, S. 1478).
- Vaterschaftstests:
Heimliche Vaterschaftsstests dürfen in gerichtlichen Verfahren nicht verwertet werden, weil sie das Recht des Kindes auf informationelle Selbstbestimmung verletzen. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch dem Gesetzgeber aufgegeben, bis Ende März 2008 einen Weg zu eröffnen, um solche Tests für zweifelnde Väter zu erleichtern. Die Klärung der Abstammung soll demnach zunächst ohne rechtliche Folgen sein (Urteil vom 13.02.2007 - 1. BvR 421/05 -)